
Das Internet kann Grenzen überwinden und Mauern niederreissen. Klingt pathetisch und ein wenig übertrieben. Stimmt aber zumindest teilweise für die Medienbranche. Im Netz werden Inhalte immer häufiger echt vernetzt und ausgetauscht, sogar zwischen Konkurrenten. Ein echter Kulturwandel ist im Gang. Das bringt den Usern Mehrwert. Und langfristig wohl auch den Journalisten.
Als Journalist musste man schon immer auch die Konkurrenz lesen. Und natürlich liess man sich auch schon früher «inspirieren» von Geschichten, die Berufskollegen ausgegraben hatten. Vielleicht schrieb man sie sogar ab, Journalisten mit Anstand und Berufsethos zitierten dann die Quelle. Mit einem dumpfen Gefühl der Schmach natürlich, weil man die Geschichte ja nun auch für den Leser ersichtlich nicht selber gefunden hat.
Heute ist alles noch viel einfacher. Im Internet-Zeitalter herrscht «copy and paste». Ich habe selber erlebt, wie Konkurrenzmedien Online-Artikel 1:1 übernommen haben. Nicht immer, aber meistens auch mit Quellenangabe. «Abschreiben» war schon in der Schule keine wirklich akzeptierte Disziplin, sie ist es auch unter Journalisten nicht. Das Weiterschreiben oder Entwickeln einer «fremden» Geschichte aber macht Sinn. Vor allem online, wo man die Originalquelle nun auf einfachste Art und Weise zugänglich machen kann.
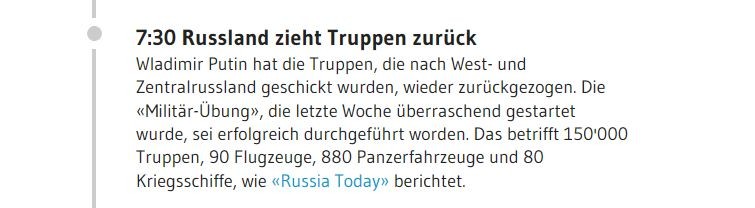
Gerade im Ausland-Ressort sind die Kolleginnen und Kollegen oft auf andere Medienberichte angewiesen: Die Lage in weit entfernten Krisengebieten ist oft unübersichtlich, eigene Korrespondenten vor Ort sind Mangelware. Schon früher bezeichnete man in Meldungen seine Quellen - zum Beispiel mit Sätzen wie «... berichten lokale Medien». Das Publikum musste mir als Journalist diese Aussage einfach glauben: Heute verlinken viele Onlinemedien direkt auf die Quellen. Wer Interesse oder Zweifel hat, kann sich den Original-Artikel selber ansehen und die Aussagen der Journalisten überprüfen.

Die Anzeige von Informationsquellen ist zu einer eigenen Kunstform geworden, gerade in der Nutzung des äusserst schnellen Kurznachrichtendienstes Twitter. Früher schrieb man von «verschiedene Journalisten berichten», heute zeigt man die Twitter-Feeds dieser Journalisten und kann das Publikum an den Primärquellen teilhaben lassen. Früher schrieb man von «Experten» oder «Kunden», die sich kritisch äussern: Heute lässt man diese Stimmen direkt im Artikel erscheinen.
Das alles ist noch keine Revolution. Und für viele Nutzer dürfte die Sichtung von Primärquellen auch eine eher untergeordnete Bedeutung haben. Aber die technischen Möglichkeiten bringen auch wirklich neue Phänomene mit sich, ja es bahnt sich sogar ein echter Kulturwandel an: Inhalte sind heute auf einfachste Weise vervielfältigbar. Journalisten können ihre «exklusiven» Geschichten oder «Primeurs» nur noch kurz als erste und exklusiv erzählen. Immer mehr Medienhäuser und Journalisten machen aus dieser Not eine Tugend: Sie scheuen sich nicht mehr davor, eigene Inhalte der Konkurrenz zur Verfügung zu stellen oder Inhalte der Konkurrenz selber zu verbreiten.

Augenfällig (weil sehr deutlich deklariert) ist die Zusammenarbeit von watson.ch mit dem deutschen Online-Magazin SPON. Einzelne Stories werden integral übernommen. Das Schweizer Onlineportal profitiert von gut gemachten Inhalten, das deutsche Onlineportal macht Werbung in eigener Sache im Nachbarland. Klar: Als regelmässiger SPON-Nutzer bringt mir die Wiederverwertung bei watson nicht viel. Aber die Zusammenarbeit ist trotzdem bemerkenswert, zumal sie in dieser Form für unser Land (noch) einmalig ist.
Viel spannender aber ist die Zusammenarbeit von sich konkurrenzierenden Medien, die nicht institutionalisiert ist. Wenn Journalisten andere Journalisten im Netz empfehlen, dann bedeutet das tatsächlich einen Kulturwandel.

SRF empfiehlt eine Recherche der NZZ auf Twitter: Eine halbe Stunde später folgt das Dankeschön der NZZ-Redaktion an die Adresse der Konkurrenz.
Hier werden tatsächlich früher vorhandene «Gartenzäune» (von wegen «Gärtchendenken») niedergerissen. Und das kann ja nur im Sinne der Leserinnen und User sein: Ein seriöser Journalist liest (von Berufes wegen quasi) Berichte von anderen Journalisten. Und wenn er einen Bericht lesenswert findet, dann empfiehlt er ihn. Der NZZ-Artikel erhält in diesem Fall eine Art «Gütesiegel» von der Konkurrenz. Und ein SRF-Nutzer erfährt davon, dass die NZZ (die er vielleicht nicht regelmässig liest) einen interessanten Artikel publiziert hat.
Das Publikum profitiert also. Wie aber sollen davon Journalisten profitieren? Ganz einfach: Wer gute, spannende, eigenständige, aufwändige oder spezielle Geschichten schafft, dem wird über sein eigenes Medium hinaus Beachtung geschenkt. Die Inhalte sind frei und damit (was v.a. Musiker stört) auch nicht mehr wirklich «geschützt». Ja, ein unprofessioneller oder böswilliger Kollege kann die Geschichte «klauen».
Gleichzeitig bedeutet die Freiheit der Inhalte aber auch, dass sie ungebremst vervielfältigt werden können und so ein viel grösseres Publikum finden, als wenn sie «nur» im eigenen Medium publiziert würden. Der Journalist muss nicht einmal zum tagesaktuellen Blogger werden, keine eigentliche Selbstvermarktung vornehmen oder sich gar als «Ich-AG» präsentieren. Wer gute Arbeit macht, dem wird diese Arbeit durch das Netz (und von den Kollegen) abgenommen.

Kommentar schreiben